Design Thinking: Ist das was für mich?

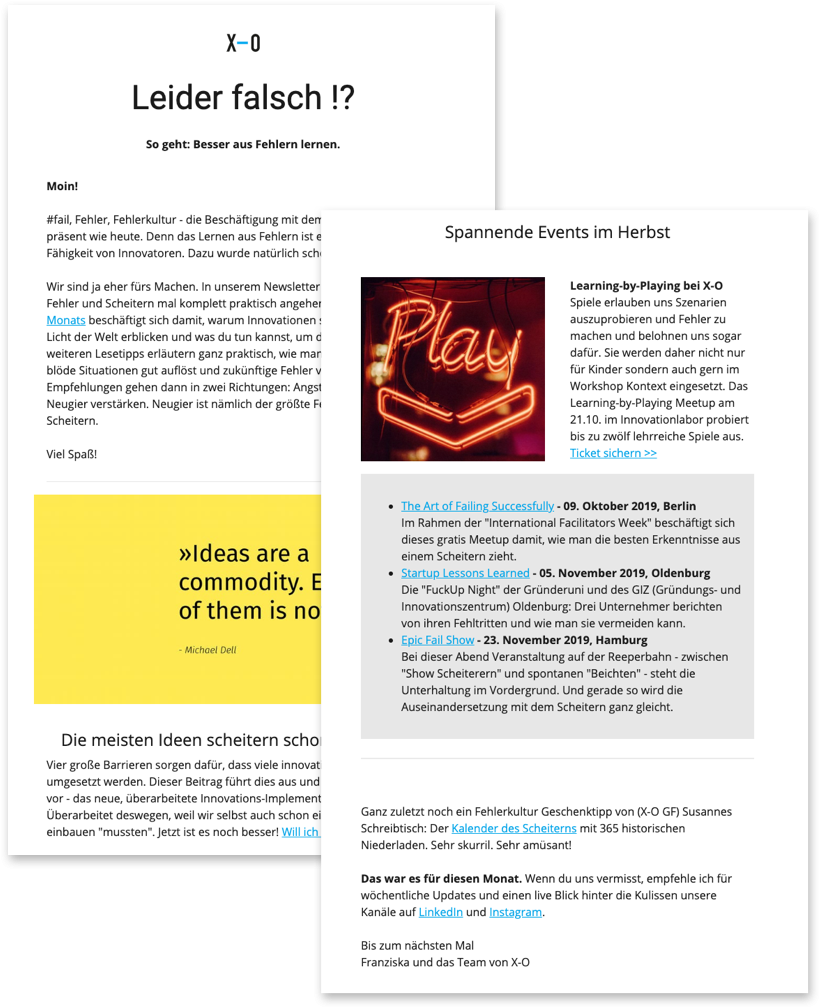
Dieser Artikel erschien auch in unserem Newsletter. Bleib auf dem laufenden und abonniere jetzt unseren Newsletter!
Design Thinking ist ein scheinbar omnipräsentes Wort aus der Innovationswelt. Es wird gern universell an alles Mögliche geklebt: Methoden, eine Denkschule, eine Herangehensweise, als Synonym für Workshops, für alles mit Post-its 😉 und so weiter. Dabei gibt es eine ganz klare Abgrenzung. Viel breiter sind jedoch die Anwendungsbereiche. Um beides soll sich dieser Beitrag drehen: ein paar tiefergehende Grundlagen zum Design Thinking und eine Antwort auf die Frage „Ist das was für mich?“. Los geht’s!
Definition von Design Thinking
Design Thinking beschreibt einen formalisierten Kreativprozess bei der Entwicklung neuer Ideen und Lösungen. Die Herangehensweise beruht auf dem zentralen Anspruch an Nutzerzentrierung, also auf der konsequenten Ausrichtung aller Ideen an den Erwartungen, Bedürfnissen und Problemen der Nutzer:innen. Formalisiert bedeutet, es werden eine Reihe von Phasen durchlaufen, um sich strukturiert der bestmöglichen (für die Nutzer:innen) Lösung zu nähern.
Der Prozess wird entweder in zwei große Teile oder in fünf gleichberechtigte Schritte zerlegt. In beiden Varianten startet man mit dem Hineindenken in die Zielgruppe (durch Primär- und Sekundärforschung), also der Zuspitzung dieser Erkenntnisse auf eine konkrete Problemstellung, die man lösen möchte. Darauf folgt eine offene, mit Kreativmethoden unterstützte Lösungsentwicklung und wieder die Zuspitzung durch Prototypen. Außerdem erfolgt eine Validierung vor der eigentlichen Umsetzung der Idee.
Werte des Design Thinking
Neben dem typischen Prozess stecken hinter Design Thinking auch vier Werte bzw. Prinzipien, die allem zugrunde liegen. Das erste ist natürlich die Nutzerzentrierung. Alle weiteren Prinzipien beschreiben das WIE, also die Frage, wie Design Thinking praktisch ausgeführt wird:
- Human-centered: Die zentrale Perspektive und Ausrichtung im Design Thinking stellt Empathie und Verständnis für die Bedürfnisse und Motive von Menschen auf die oberste Ebene.
- Collaborative: Beim Design Thinking arbeitet ein idealerweise heterogenes Team zusammen. Der Blick aus verschiedenen Perspektiven fördert die eigene Kreativität und die Mischung ermöglicht einen viel größeren Lösungsraum.
- Optimistic: Design Thinking basiert auf dem Glauben, dass Veränderungen geschaffen werden können und der Prozess der Innovationsentwicklung etwas Aufregendes und Schönes ist. Es wird grundsätzlich positiv gedacht und neue Ideen werden immer begrüßt.
- Experimental: Design Thinking hat einen offenen Ausgang. Es werden Annahmen und Lösungen dafür entwickelt, die aber nochmal durch den Nutzertest gehen. Fehler dürfen passieren, denn durch die Verwendung der Erkenntnisse aus „Fehlern“, wird die Lösung ein Stück besser.
Design Thinking wurde übrigens schon um 1990 von der Innovationsagentur IDEO geprägt und durch die Weiterentwicklung des Hasso-Plattner-Instituts mit der “School of Design Thinking” ab 2007 auch in Deutschland etabliert.
Und warum steckt jetzt eigentlich das Wort Design drin, wenn es doch eigentlich um Innovation geht? Das hat auch mit IDEO zu tun, wo Innovation von Design-Teams vorangetrieben wurde und wird. Und deren Perspektive (im Vergleich zu beispielsweise klassischen Unternehmensberatern oder New Business Managern) setzt von jeher an der Prämisse einer Arbeit für Menschen und nicht entlang von Marktzahlen und Unternehmenszielen an.
Design Thinking vs. Design Sprints
In einer Welt des zunehmenden Buzzword Bingos kursiert im Umfeld von Design Thinking oft auch ein anderer Begriff, nämlich der Design Sprint. Beides wird dabei auch gern verwechselt. Ich möchte daher kurz einmal die Abgrenzung klären.
In einem Satz: Während Design Thinking eher grobe Prozessschritte umreißt, die flexibel wiederholt werden können, hat ein Design Sprint einen festgeschriebenen superschnellen Ablauf – daher auch Sprint – und ein klares Zielbild.
Ziel des Design Sprints ist es, in kürzester Zeit einen ziemlich konkreten Prototypen zu erschaffen und zu überprüfen. In seiner Urform dauert ein Design Sprint 5 Tage und passt genau in eine Arbeitswoche von Montag bis Freitag. In einer verkürzten (aktuell nach meiner Erfahrung häufiger verwendeten) Form sind es sogar nur 4 Tage.
Falls du mehr wissen willst: Ich habe an anderer Stelle einen ganzen Artikel dazu geschrieben.
Fachbegriffe und Inhalte aus der Welt des Design Thinking
Dazu kommen noch viele weitere Begriffe, die dir im Kontext von Design Thinking sicher immer wieder begegnen. Hier kommt ein kurzer Glossar zu den, meiner Meinung nach, wichtigsten:
Brainstorming
Brainstorming ist die vermutlich bekannteste Methode, die auch im Design Thinking verwendet wird. An vielen unterschiedlichen Stellen werden Probleme oder Ideen gesammelt. Dazu wird der Input aller kollaborativ arbeitenden Teilnehmer zusammengestellt. Das kann direkt aufeinander aufbauend erfolgen (Brainstorming) oder im ersten Schritt unabhängig von einander (Together Alone Methode). Ich bin definitiv eine Verfechterin des Letzteren und erkläre hier ausführlich warum.
Diverge & Converge
Diverge bedeutet aufmachen bzw. auseinandergehen und Converge zumachen bzw. zusammenlaufen. Das ist das typische Design Thinking Vorgehen: Zunächst viel, unbewerteten Input aus dem Team sammeln und erst dann bewerten und priorisieren, um das wichtigste Problem oder die beste Lösung für den nächsten Schritt auszuwählen. Visualisiert man dieses Vorgehen, entsteht eine Diamantenform.
Double Diamond
Im Design Thinking Prozess, der zwei große Phasen unterscheidet, gibt es mindestens zwei Mal das typische Diverge & Converge Vorgehen, nämlich zuerst im Problemraum und danach im Lösungsraum. Das heißt, im ersten Schritt werden möglichst viele Probleme (aber auch Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche) einer Zielgruppe gesammelt und dann eines ausgewählt. So entsteht der erste Diamand. Auf dieser Basis werden möglichst viele Lösungsansätze zum Kernproblem gesammelt, woraus erst im Anschluss wieder die beste Idee ausgewählt wird. Daraus ergibt sich der zweite Diamand.
Empathize
Im fünf Stufen Prozess ist Empathize – also sich empathisch hineinversetzen – der erste und eigentlich wichtigste Schritt. Im Deutschen haben wir kein ordentliches Verb dafür, aber ein Nomen, nämlich die Empathie. Das Schöne ist, beim Design Thinking muss man Empathie nicht als starke Charaktereigenschaft mitbringen. Man bekommt sie durch unterschiedliche Arten von Forschung, z.B. Tiefeninterviews, Gruppeninterviews, Beobachtung, Tagebücher, Verwenderstudien, Marktstudien und, und, und.
Persona
Personas beschreiben eine:n Vertreter:in der Zielgruppe und betrachten dabei vor allem Ziele, Motive und Barrieren und beziehen nur sekundär demografische Faktoren mit ein. Sie werden häufig am Anfang von Design Thinking Prozessen als Zuspitzung der Erkenntnisse über die Nutzer:innen angelegt und dienen als Grundlage und Verständnishilfe für die weitere Arbeit.
Prototyp
Ein Prototyp ist ein einfaches Musterexemplar bzw. Modell einer Lösung, um anhand dessen im Test schnell Feedback einzuholen und frühzeitig zu sehen, ob eine Idee gut und relevant ist. Prototyping, also die Erstellung eines Prototypen, ist ein zentraler Schritt im Design Thinking.
Value Proposition Canvas
Der VPC ist ein tolles Tool aus den neueren Design Thinking Methodenkoffern, das hilft, sich strukturiert in die Lebenswelt, Motive und Barrieren von Menschen einzuarbeiten und daraus Ideen abzuleiten. Der Begriff ist dabei etwas irreführend, weil es im Kern gar nicht um die Value Proposition (also das zentrale Versprechen an die Nutzer:innen) geht. Es geht darum zu verstehen, wie Wert entsteht.
Ist Design Thinking für mich bzw. uns?
Kommen wir zur großen finalen Frage: Wer braucht eigentlich Design Thinking und wofür? Die Möglichkeiten sind riesig. Der nutzerzentrierte Prozess und Methodenkoffer kann fast auf jede Art von hauptsächlich geistiger Zusammenarbeit angewendet werden, die strukturiert und im Team erfolgen soll.
Jedes Team Meeting, das mehr will, als nur zu informieren, und stattdessen konkret etwas erschaffen möchte, kann sich einzelner Design Thinking Methoden bedienen. Die nutzerzentrierte Herangehensweise sorgt dafür, dass das Denken sich ganz klar auf den Endnutzen ausrichtet.
Der zentrale Anwendungsfall sind dabei natürlich einerseits klar umrissene Herausforderungen bei bestehenden Produkten und Services. Hier ein paar beispielhafte Fragen:
- Wie können wir besser auf Nutzer:innen-Feedback reagieren?
- Wie können wir Kund:innen länger an uns binden?
- Wie können wir unser Produkt optimieren?
Die andere Anwendungskategorie sind Innovationsvorhaben, die idealerweise mit ganz offenen Fragen wie diesen angegangen werden:
- Wie können wir wachsen?
- Wie können wir eine ganz neue Nutzer:innenschaft erschließen?
- Wie können wir uns besser für die Zukunft aufstellen?
Bricht man das auf Menschen und Unternehmen herunter, ist Design Thinking hochrelevant für:
- Teams, die gerade an einem konkreten Thema arbeiten und neuen Input suchen
- Teams, die neue Produkte und Services entwickeln wollen
- Teams, die aus bestehenden Lösungen und Ideen die besten priorisieren und umsetzen wollen
- Facilitators und Consultants die Problemlösungs- und Produktentwicklungsprozesse begleiten
- Unternehmer:innen, die ihre Business Strategie aufsetzen oder aktualisieren wollen
- Unternehmer:innen, die eine grundlegende nutzerzentrierte Denk- und Vorgehensweise einführen wollen
- Gründer:innen, die ihr Geschäftsmodell entwickeln oder neu justieren wollen
Wenn mindestens eine dieser Punkte auf deine Situation zutrifft, ist Design Thinking wahrscheinlich hilfreich und potentiell sehr wirksam für dein Team. Wir helfen gerne dabei, diese Wirksamkeit zu entfalten! Je nach Fragestellung und Größe des Teams bieten wir von XO Projects passende Prozesse, wie den Ideas Sprint, den Aufbau einer Innovationskultur oder den Lean Innovation Kickstart auf Basis von Design Thinking. Sprich uns an!
Fazit
Design Thinking ist ein nutzerzentrierter Prozess zur Problemlösung und Innovationsentwicklung, der sich spätestens seit 2007 auch in Deutschland durchgesetzt hat. Der Prozess startet mit dem Hineinversetzen in die (potentiellen) Nutzer:innen und endet mit dem Test eines Prototypen, aus dem eine valide Produktentwicklung hervorgeht. Er setzt neben der Nutzer:innenbrille auf Kollaboration, positives Denken und Experimentieren. Design Thinking ist dabei auf unterschiedlichste Herausforderungen anwendbar und produziert dabei Ergebnisse, die der realen Anwendungssituation bzw. dem echten Markt auch standhalten.
Weiterführende Links
Downloads
Artikel
- Design Thinking ist nicht tot! – Aber oft falsch verstanden
- Die Evolution des Double Diamonds
- Kundenzentriert arbeiten mithilfe von Personas
- Woran scheitern Innovationen? Die vier wichtigsten Faktoren
Mit XO Projects arbeiten
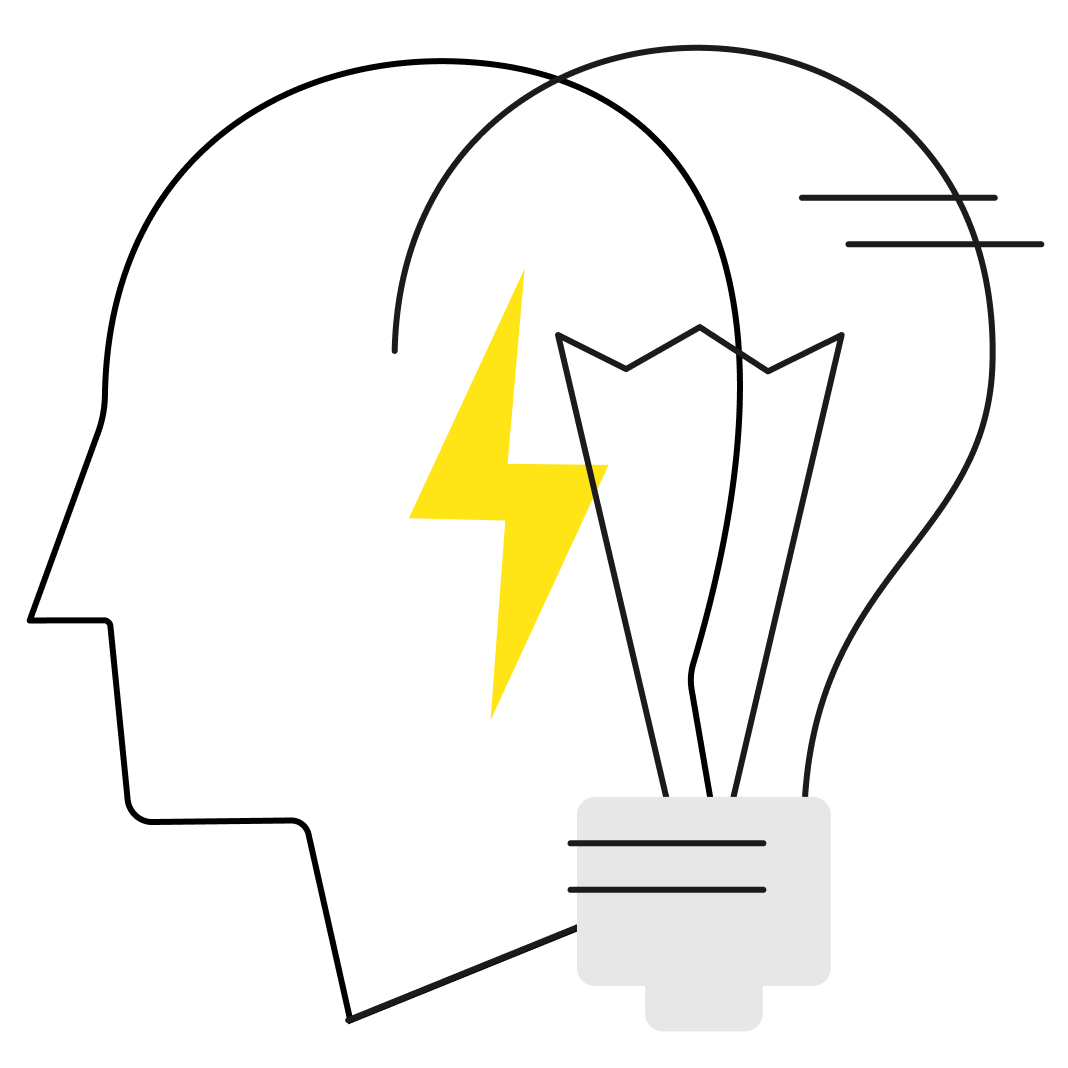
Der XO Ideas Sprint
Dieser schlanke Prozess auf Basis von Design Thinking hilft dir, eine Vielzahl von nutzerzentrierten Ideen zu entwickeln, zu testen und Grundlagen für die Umsetzung zu schaffen.
Du willst mit uns arbeiten?
Schreib uns und erzähl uns von den Herausforderungen, vor denen Du gerade stehst. Wir freuen uns auf Deine Nachricht!
ruf uns an: 040 180 738 26 oder vereinbare direkt einen Termin für ein erstes Gespräch.
Das könnte dir auch gefallen
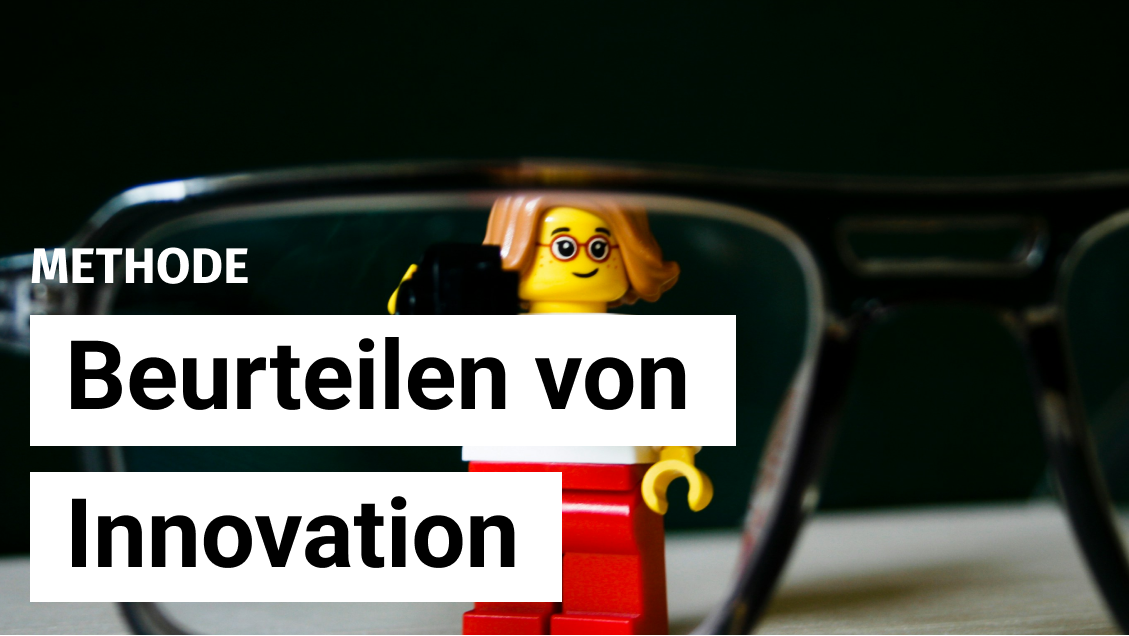
Innovation beurteilen für eine bessere Innovationsstrategie

Es ist Zeit für echtes New Work
